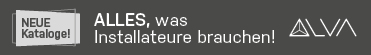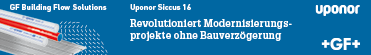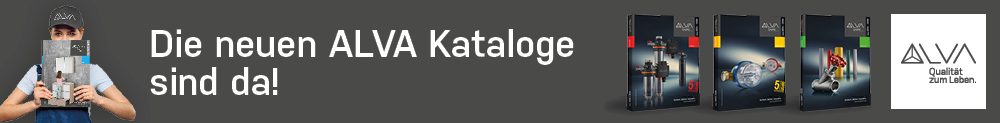Der Wärmepumpen-Aktionsplan:
Umweltrelevante Einsparpotentiale

v.l.n.r: DI Karl Ochsner (Obmann BWP), Ing. Dr. Georg Patay (stellvertretender Obmann BWP), Dr. Herbert Greisberger (Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik/ÖGUT)
Die herrschende Energie- und Umweltsituation waren Veranlassung für diesen Aktionsplan, der im Zuge der klima:aktiv Initiative des Lebensministeriums vom Bundesverband WärmePumpe, BWP, in Kooperation mit der Leistungsgemeinschaft Wärmepumpe Austria, LGWA, den beiden Interessensvertretungen der Wärmepumpen-Branche, erstellt wurde.
Ziel war es, energetische und umweltrelevante Einsparpotenziale aufzuzeigen, die bis zum Jahr 2020 durch einen forcierten Wärmepumpen-Einsatz in den Bereichen Heizung, Warmwasser-Bereitung und Klimatisierung in österreichischen Ein- und Mehrfamilienhäusern (bis zu drei Wohneinheiten), sowie Gewerbe- und Industriebetrieben und Dienstleistungsunternehmen erzielbar sind.
Zukunfts-Technologie Bewertung
Dazu Dr. Herbert Greisberger von der ÖGUT, der österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik, die das Programm klima:aktiv haus, einem wichtigen Teilbereich der Initiative klima:aktiv, betreut: „Die herrschende Energie- und Umweltsituation und das sich deutlich abzeichnende Zukunftsszenario ermahnen zum Umdenken und zu einer Änderung des Energiekonsums. Im Mittelpunkt steht dabei die Errichtung energiesparender Gebäude wie klima:aktiv- und Passivhäusern. Wir werden aber auch verstärkt auf erneuerbare Energien setzen müssen, um die Herausforderungen zu bewältigen. Die Wärmepumpe wird dabei als intelligente, effiziente und emissionsmindernde Technologie, die regenerative Energie, also Umweltwärme, nutzt, an Bedeutung gewinnen.
Das Ausmaß dieser Bedeutung soll der nun vorliegende Wärmepumpen-Aktionsplan aufzeigen. „Wir sind davon ausgegangen“, so Dr. Gerald Lutz, der Verfasser der Studie, „dass 76 Prozent der künftigen Neubauten und in zwei getrennten Szenarien 20 bzw. 50 % der Sanierungen mit Heizungs bzw. Warmwasser-Wärmepumpen ausgestattet werden könnten.“ Bei den Wirtschaftsbetrieben wurden die Wärmepumpen-Anteile je nach Branche und Betriebsgröße zwischen fünf und 50 Prozent angenommen. Im Bereich Klimatisierung stand man der Wärmepumpe einen realistischen Marktanteil von 25 Prozent bis 2020 zu. Damit sind folgende Wirkungen zu erzielen: 2,3 Millionen Tonnen weniger CO2
Inhalt:
Die CO2-Emissionen könnten um bis zu 2.368.000 Tonnen sinken! „Bedenkt man, dass das mit zehn Millionen Tonnen CO2 festgelegte Kyotoziel Österreichs oftmals als unerreichbar bezeichnet wird, erscheint dieses Einsparpotenzial umso beeindruckender. Denn allein durch den forcierten Einsatz von Wärmepumpen in Österreich wäre fast ein Viertel der Vorgabe realisiert“, so Dr. Georg Patay, stellvertretenden Obmann des BWP. Schon heute könne sich die Umweltverträglichkeit von Wärmepumpen sehen lassen, argumentiert Patay, wofür er sich von Univ.-Prof. Dr. Gerhard Faninger, Universität Klagenfurt, die Bestätigung holt. Bereits im Jahre 2006 ersetzten z. B. die in Österreich in Betrieb befindlichen Wärmepumpen 248.879 Tonnen Heizöl pro Jahr. Das entspricht einer Tankwagenkolonne (= 30.000 l, 16 m + 34 m vorgeschriebener Abstand) von 531 Kilometer. Das CO2-Äquivalent betrug 671.973 Tonnen pro Jahr, unter Berücksichtigung des österreichischen Strommixes 526.531 Tonnen, wobei die Tankwagenkolonne „nur“ 416 Kilometer lang wäre. Im Vergleich dazu die Solaranlagen: Sie ersetzten 181.200 Tonnen Heizöl pro Jahr, was einer Tankwagenkolonne von 387 Kilometer entsprechen würde und 489.000 Tonnen CO2.
CO2-Reduktion als Förderkriterium
Selbst wenn der berühmte gesunde Hausverstand für den forcierten Einsatz von Wärmepumpen spricht, so stellen vor allem Genehmigungskriterien seitens der öffentlichen Hand, hohe Barrieren dar. Sie sind kontraproduktiv zu den Klimaschutzzielen und der Energiepolitik Österreichs. Der BWP fordert daher eine österreichweit einheitliche Wärmepumpen-Förderung, die CO2 reduzierende
Maßnahmen als Förderkriterium einführen. Dipl.-Ing. Karl Ochsner, Obmann des BWP, fordert in diesem Zusammenhang die absolute Gleichstellung aller erneuerbaren Energien. Dazu zählt Umgebungswärme welche bekanntlich absolut emissionsfrei ist zur nobelsten Erneuerbaren. Diese lässt sich durch die Wärmepumpe nutzen. Weiters verweist Ochsner auf das australische Fördermodell, nach welchem alleine die CO2-Einsparung Kriterium für die Förderhöhe ist. Dort bekommt der Anlagenbetreiber unabhängig von der eingesetzten Technologie „Solar Credits“ als Gegenwert, den sein System in den nächsten zehn Jahren an CO2 einspart bezuschusst.
Gleichstellung der erneuerbaren Energien
„Subventionen sind Steuermittel. Sie müssen effizient eingesetzt werden“, folgert Ochsner, „in Zeiten, in denen der Rohölpreis über 80 $ liegt, die Gasversorgung aus Russland über die neue Pipeline zum strategischen Instrument wird und kein Ende des Verbrauchsanstieges für die begrenzt vorhandenen fossilen Energien abzusehen ist, benötigen wir aus energiepolitischen, ökonomischen, aber insbesondere ökologischen Gründen nachhaltige Alternativen. Es gilt alle erneuerbaren Energieformen zu nutzen. Denn keine einzige von ihnen wird alleine imstande sein, unsere Energiezukunft und den Klimaschutz zu sichern. Deshalb dürfen wir uns weder den Luxus noch die Kurzsichtigkeit erlauben, einzelne davon zu benachteiligen oder gar auszuschließen.